| Der Film | Die Trilogie | Der Regisseur | Passion Hölderlin | Downloads | Presse | Vertrieb/Kontakt |
| Hölderlin Comics | |||||||
|
D 1994, 90 Min., Farbe und s/w Regie und Produktion: Harald Bergmann Buch: Harald Bergmann nach Texten von Hölderlin, Goethe, Schiller, Bettina von Arnim, Schelling u.a. Darsteller: Udo Samel (jüngerer Hölderlin), Walter Schmidinger (älterer Hölderlin), Otto Sander, Rainer Sellien und Tina Engel sowie die Stimmen von Dietrich E. Sattler und Martin Heidegger |
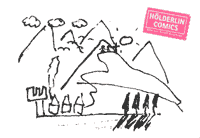 |
| Im September 1806 wurde der Dichter Friedrich Hölderlin mit Gewalt aus seinem Haus geholt, im Auftrag seiner Familie in ein Klinikum für Geisteskranke gebracht und dort interniert. Dem voraus ging eine Verwicklung des Dichters in eine politische Verschwörung um seinen Freund und Protégé, den Diplomaten Isaak von Sinclair. Im Zuge der Aufdeckung dieser Verschwörung wurde von Sinclair verhaftet, nach seiner Freilassung mangels Beweisen betrieb er selbst aktiv den Abtransport des ehemaligen Freundes. | |
| Filmischen Auseinandersetzungen mit dem Thema "Hölderlin" geht es zumeist darum, die biographische Legende und den aus diesen Umständen entstandenen Mythos vom "wahnsinnig gewordenen Dichter", der an seiner tragischen Liebe und in der Kunst wahnsinnig wird, aufzubereiten. Im Gegensatz dazu wird in diesem Film versucht, die Arbeit des Dichters selbst, die kaum bekannten Texte, die er bis kurz vor und noch kurz nach seinem Abtransport schrieb, vorzustellen und sie in filmischen Kategorien umzusetzen. Sie werden zugleich der Rezeption, der Einschätzung durch Freunde, Zeitgenossen, der Literaturszene u. a. gegenüber gestellt. | |
| Die zitierten Dialoge, z. B. die Gespräche zwischen Goethe und Schiller über Hölderlin, sind wortwörtlich aus Briefen zitiert, kein Wort in diesem Film ist frei erfunden. Es ist dies gleichwohl kein Dokumentarfilm; das Ziel war, auch innerhalb einer experimentellen Form eine Geschichte zu erzählen. Der hier verwendete "Comic"'-Begriff ist das Gegengift für die Vereinnahmung, wie sie im Faschismus stattfand und im staatstragenden Klassiker-Image fortwirkt. Er ist weniger inhaltlich im Sinne von Comedy oder Cartoons zu verstehen, sondern bezieht sich auch formal auf den Umstand, dass hier poetische Sprache in Film, in Bilder und filmische Kompositionen umgesetzt ist. | |